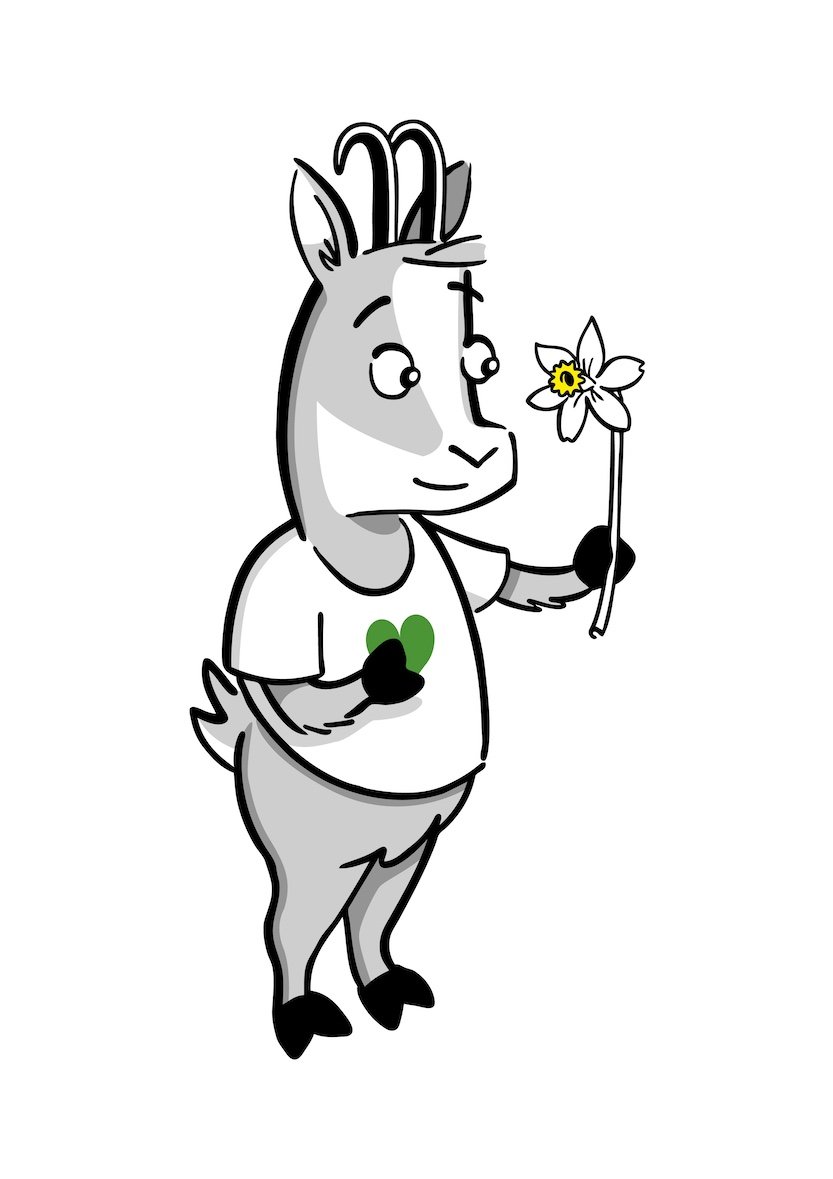SAGENWEG AUGSTI
DER SAGENHAFTE WEG AM LOSER (Juni 2025)
THE LEGENDARY PATH AT LOSER (June 2025)
LEGENDÁRNÍ STEZKA NA LOSERU (červen 2025)
Klein & FEIN
Der Sagenweg AUGSTI geht direkt von der Loser-Zwischenstation Richtung Stellenkogelhütte, die auch im Sommer geöffnet hat. Es sind fünf Stationen, d.h. auch für die Kleinsten ist der Weg machbar. Die Schritte werden demnächst gezählt. Es ist ein kleiner Spaziergang, je nach Aufenthalt bei den Sagenstationen 20 bis 30 Minuten.
Augsti geht gerne am LOSER wandern. © Philipp Pamminger
HERZLICH WILLKOMMEN BEIM SAGENWEG AUGSTI!
WELCOME TO THE LEGEND TRAIL AT LOSER!
SRDEČNĚ VÍTÁME NA AUGSTI – STEZKA POVĚSTÍ!
Das Salzkammergut birgt einen immensen Schatz an mündlichen Überlieferungen, Geschichten und Sagen. Diese Erzähltraditionen spiegeln aber nicht nur die enge Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat und mit der Natur wider, sondern sie sind ebenso ein Zeichen der tiefen Verwurzelung in einer reichen Kulturgeschichte. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb eine jede einzelne Ecke im Salzkammergut mit vielen faszinierenden oder abenteuerlichen Geschichten verwoben ist. Ein Großteil dieser Sagen und Mythen umrankt die majestätische Berglandschaft, und bei einigen spielen sogar Almgeister eine wichtige Rolle – so auch in der folgenden, ersten Erzählung DAS GOLDENE BRÜNDL.
DAS GOLDENE BRÜNDL
Illustration © Philipp Pamminger
Das Bevölkerungswachstum in der gesamten Region nahm rasch und stetig zu. Dadurch stieg allerdings auch der Bedarf an größeren Weideflächen beziehungsweise waren größere Herden an Schafen, Ziegen und vor allem Milchkühen notwendig, da die Nachfrage nach Milch, Käse und Fleisch sowie Wolle und Leder ebenfalls wuchs. Aus diesem Grund mussten die Bauern klug und vorausschauend handeln. Sie entschlossen sich daher dazu, jeden einzelnen Quadratmeter des zur Verfügung stehenden Bodens optimal zu nutzen. Deshalb begannen sie damit, am Beginn eines jeden Sommers ihre Tiere auf die Almen zu treiben. Das hatte zum einen den Vorteil, dass das Gras in diesen höheren Lagen nicht mehr regelmäßig und unter großen Anstrengungen gemäht, transportiert und gelagert werden musste. Dadurch ersparten sich die Tierhalter viel Arbeit und Kosten. Sie sparten während dieser Zeit aber auch Gras der Felder im Tal ein, das sie stattdessen im Winter als Heu verfüttern konnten. Zum anderen trugen die vielen Tiere mit ihren Hufen regelmäßig dazu bei, das steile Gelände zu befestigen, was zu einer sogenannten Durchwurzelung des Bodens auf den Almen führte. Ein gut durchwurzelter Boden kann unter anderem Schutz vor Muren bieten, weil er mehr Wasser aufnehmen und speichern kann.
In heißen Sommern konnte es trotzdem immer wieder passieren, dass die zahlreichen Quellen auf den Bergen im Ausseerland zur Gänze versiegten und es daher nicht mehr genug Wasser zum Tränken der Tiere auf den Almen gab – ebenso auf der Oberwasseralm. Die Sennerinnen und Senner, die dort während der Sommer Milchkühe sowie junge Rinder beaufsichtigten, trieben das Vieh deshalb in solchen Fällen weiter hinauf auf den Hochklapfsattel*. Als „Sattel“ bezeichnet man allgemein eine Vertiefung an einem Bergrücken zwischen zwei Gipfeln. Der Name „Hochklapfsattel“ leitet sich aus der Zusammensetzung von „hoch“ sowie dem Dialektbegriff „Klapf“ für „Fels“ ab und beschreibt einen bestimmten Weg mit Felsenstufen zwischen dem Loser und der Trisselwand. Auf besagtem Hochklapfsattel befindet sich ein kreisrundes, senkrechtes und etwa ein Meter tiefes goldfarbenes Loch im Felsen, das immer mit Wasser gefüllt ist. Es heißt, die wohlgesinnten Berggeister hätten den Almleuten das sogenannte Goldene Bründl vor langer, langer Zeit gezeigt, damit deren Tiere dort oben niemals Durst leiden mussten.
* Als „Sattel“ bezeichnet man allgemein eine Vertiefung an einem Bergrücken zwischen zwei Gipfeln. Der Name Hochklapfsattel leitet sich aus der Zusammensetzung von „hoch“ sowie dem Dialektbegriff „Klapf“ für „Fels“ ab und beschreibt einen Weg mit Felsenstufen zwischen dem Loser und der Trisselwand.
DER WASSERMANN VOM ALTAUSSEER SEE
Viele Male sahen die Leute von Arzleiten (das ist ein Ortsteil von Altaussee), als sie auf dem Weg zur Kirche waren, beim Hügel oberhalb der Villa Nassau (dort befindet sich heute die Schiffsanlegestelle) im Altausseer See einen nackten Mann schwimmen. Dabei ragte sein Oberkörper immer wieder einmal aus dem Wasser, der untere Teil seines Körpers hingegen war fischartig und nur zu sehen, wenn man genau hinschaute.
Illustration © Philipp Pamminger
Eines Tages wagten es die Menschen, den Mann im See anzusprechen. Da sagte er zu ihnen, dass er drei für die Bewohner von Arzleiten sehr nützliche Dinge wisse. Als sie um das erste fragten, deutete er auf den Sandling und erklärte ihnen, dass in den roten Steinen dieses Berges Salz enthalten sei. Dieses könnten sie mithilfe von Wasser lösen und anschließend aus diesem heraussieden. Zudem würden sie auf saure Quellen stoßen, wenn sie tief genug graben würden. Erstaunt hörten die Leute zu, aber bei all der Aufregung dachte niemand daran, nach den anderen wichtigen Dingen zu fragen. Da sprach der Wassermann: „Einen Teil habe ich euch nun gesagt. Aber um das Wichtigste habt ihr zu fragen vergessen, nämlich wie man aus der ‚Juttn‘* das Gold siedet und warum in der Kranewettbeere* ein Kreuz ist und deshalb jeder vor dieser Staude den Hut abnehmen soll.“ Danach tauchte er unter und verschwand für immer.
Die vom Wassermann erwähnte „Juttn“ ist im regionalen Dialekt die Bezeichnung für den wässrigen Rückstand, der bei der Zubereitung von „Schotten“ entsteht. Der „Schotten“ wiederum ist ein topfenähnlicher und krümeliger Käse, der meist aus der Milch hergestellt wird, die am Ende der Saison, also vor dem alljährlichen Almabtrieb, gewonnen wird.
Die „Kranewettbeere“ (sie wird in anderen Regionen Österreichs sowie in Süddeutschland auch „Kranewittbeere“ genannt) ist im Ausseerland die Bezeichnung für die Wacholderbeere. Einer Legende nach soll das Kreuz Christi auch Wacholderholz enthalten haben, weshalb den Überlieferungen zufolge auf den Beeren ein deutliches Kreuzzeichen zu sehen sei. Damals glaubte man, das Kreuz auf den Wacholderbeeren vertreibe alles Böse und schütze vor bösen Geistern – daher wohl auch der Hinweis des Wassermanns, dass man vor einem Wacholderstrauch aus Respekt den Hut abnehmen solle.
Die Botanik liefert hingegen eine wissenschaftliche Erklärung für das weißliche und kreuzähnliche Zeichen: Es entsteht normalerweise durch das Verwachsen der Fruchtblattschuppen, bevor sich die Beere ausbildet und heranreift.
Die Leute von Arzleiten machten sich indes daran, den Rat des Wassermanns zu befolgen. Sie begannen am Sandling, oberhalb vom Moosberg, zu graben. An einer Stelle, wo die Schafe immer an der Erde leckten, weil die Quellen am Fuße des Berges salzhaltig waren – so entstand der erste Stollen. Sein ungefähres Alter konnte man anhand dort gefundener Holzstämme ermitteln, die vor allem dazu benutzt wurden, um den Stollen zu stützen. Diese Holzstämme waren nur mit Äxten bearbeitet worden, da Sägen zur damaligen Zeit noch unbekannt waren.
* Juttn ist im regionalen Dialekt die Bezeichnung für „Molke“, die bei der Zubereitung von Topfen und Käse entsteht.
** Die Kranewettbeere (in anderen Regionen und in Süddeutschland auch Kranewittbeere) ist der regionale Name für die „Wacholderbeere“. Einer Legende nach soll das Kreuz Christi auch Wacholderholz enthalten haben, weshalb auf den Beeren ein Kreuzzeichen zu sehen sei. Damals glaubte man, das Kreuz auf den Wacholderbeeren vertreibe alles Böse – daher auch der Hinweis des Wassermanns, dass man vor einem Wacholderstrauch den Hut abnehmen solle.
Die Botanik liefert eine andere Erklärung für das weißliche und kreuzähnliche Zeichen: Es entsteht normalerweise durch das Verwachsen der Fruchtblattschuppen, bevor sich die Beere ausbildet und heranreift.
DAS GESCHENK AN DIE SALIGEN
Die „Saligen“* sind mystische weibliche Gestalten der Sagenwelt im Ausseerland, die auch Macht über die unterschiedlichen Almgeister besaßen. Die Almgeister selbst erfüllten verschiedene Aufgaben und waren meist freundlich und wohlgesonnen. Sie wachten über das Vieh auf der Alm, indem sie die Herde zusammenhielten, Rinder vor dem Abstürzen an steilen Felshängen bewahrten oder manchmal den Sennerinnen und Sennern dabei halfen, verirrte Jungtiere zu finden. Für ihre Dienste erhielten die Almgeister oftmals einen kleinen Teil der auf den Almen produzierten Milchprodukte. Wenn sie gereizt wurden oder man ihre Hilfsbereitschaft gar als selbstverständlich ansah, konnten sie allerdings mitunter zornig werden. Daher war es Brauch, sich bei den Almgeistern am Ende der Saison noch einmal für ihren Beistand während der Sommermonate zu bedanken.
Illustration © Philipp Pamminger
Nicht anders war es auf der Schoberwiesalm, auf der mehrere Almhütten stehen. In diesen wohnten während der Sommermonate fleißige Sennerinnen. Eine davon, eine junge Bauerntochter namens Leni, hatte einige Milchkühe und Jungvieh zu versorgen. Die Kühe mussten zweimal täglich mit der Hand gemolken werden, was sehr anstrengend war. Aus der Milch wurden hauptsächlich Rahm und Butter hergestellt, am Ende des Sommers dann auch oftmals Schotten**, ein topfenähnlicher und krümeliger Käse. Jeden Sonntag wurden die auf der Alm erzeugten Lebensmittel in einem Almfachtl***, das ist ein spezielles Gefäß aus Holz, das entweder mit dem Kopf oder in Kombination mit einem Tragegestell am Rücken getragen wurde, ins Tal hinuntergebracht.
Viel zu schnell verging der Almsommer für Leni und der Herbst stand vor der Tür. Die junge Sennerin musste nun die Alm mitsamt dem Vieh verlassen und auf den Bauernhof im Tal zurückkehren. Bevor es jedoch so weit war, hatte sie noch die heiß begehrten, köstlichen Almraunggerl gebacken, die sie den Kindern und den Bauersleuten mitbrachte. Eine kleine Schüssel damit ließ sie aber in der Hütte auf dem Tisch zurück. Dies war ihr Dank an die guten Almgeister, die von nun an die Hütte bewohnten und auf diese aufpassten.
Im Tal angekommen, bemerkte Leni, dass sie ihren Buttermodel in der Almhütte vergessen hatte. Der Model, in manchen Regionen sagt man auch das Model, ist eine spezielle Form aus Holz, mit welcher man der Butter ihre Form – zum Beispiel rechteckig oder rund – gibt. Zudem konnte man damit individuelle Muster in die Butter prägen. Auch für Raunggerl gibt es eigene Raunggerlmodel.
Leni ging nun, so schnell sie konnte, den steilen Weg zur Almhütte zurück und sperrte die Hüttentüre auf. Als sie die Hütte betreten hatte, erschrak sie fürchterlich, denn in der Schüssel lagen statt der Almraunggerl nur noch lauter kleine Kohlenstücke. Schnell nahm Leni das Buttermodel, schob ein Stückchen Kohle in ihre Kitteltasche und eilte ins Tal zurück. Als sie die Kohle am Abend aus ihrem Kittel nahm, war sie überrascht, denn sie hielt plötzlich ein funkelndes Goldstück in ihren Händen. Damit wurde Leni von den Almgeistern für ihr gutes Herz und ihre Fürsorglichkeit belohnt.
Du möchtest die Almraunggerl probieren? Klick unten auf das Austi-Bild, so kommst du direkt zum Rezept.
* Die „Saligen“ sind scheue, liebenswerte Wesen aus der Sagenwelt und besitzen magische Fähigkeiten. „Sal“ bedeutet in etwa „heilend“, „die Heilenden“ oder „die Weisen“.
** „Schotten“ ist im regionalen Dialekt die Bezeichnung für den krümeligen topfenähnlichen Rückstand von gefilterter Buttermilch.
*** Ein „Almfachtl“ ist ein rundes, niedriges Holzgefäß zum Transport von Lebensmitteln. Die Sennerinnen trugen das Almfachtl, eingebunden in einem Tuch, meist auf dem Kopf.
DIE SAGE VOM WALDGRABnerhof
Im Altausseer Ortsteil „Waldgraben“ befanden sich die sogenannten Waldgrabnerhöfe, die Schauplatz der nachfolgenden Sage sind. Waldgraben liegt etwas versteckt hinter dem Pflindsberg – ein bewaldeter Hügel am Fuße des Sandling und Standort der Ruine Pflindsberg.
Damals kamen „wällische“ Erzsucher, die meist „Venedigermandl“, in Altaussee aber oft nur „Wauggerl“ genannt wurden, bis ins Ausseerland. Der Begriff „wällisch“ ist eine regionale Variante der mittel- und neuhochdeutschen Begriffe „walsch“ bzw. „welsch“. Diese Bezeichnungen wurden in einigen Gebieten Österreichs vorwiegend für Menschen aus Ländern verwendet, die eine romanische Sprache, wie etwa Italienisch, sprachen.
Bei den Fremden handelte es sich um Schatzsucher, die sich, um nicht aufzufallen, häufig als Reisende oder Hausierer tarnten. Sie kamen meist aus Venedig oder benachbarten Städten in Italien hierher und waren auf Bergen sowie in Flüssen auf der Suche nach Gold, Silber und Edelsteinen. Ihnen wurde nachgesagt, dass sie die Schmiedekunst exzellent beherrschten und Zauberspiegel besitzen würden, die ihnen dabei halfen, wertvolle Bodenschätze aufzufinden.
Illustration © Philipp Pamminger
Während die erfahrenen Erzsucher in der Region waren, übernachteten sie in den Stadln der Bauern. So auch jener, der über Jahre sein Quartier beim Waldgrabner-Bauern aufschlug. Er war sehr darauf bedacht, dass ihm nie jemand folgte. Er war klein und wendig, schlich fast lautlos durch den Wald und war viele Tage auf dem Berg unterwegs. Mit seiner Kraxn, das ist ein Tragegestell aus Holz, brachte er immer wieder einige Steine mit ins Tal. Eines Tages sagte er zum Waldgrabner: „Heute gehe ich fort und komme nie wieder.“ Als Dank ließ er nur ein paar Steine zurück. Der Bauer ärgerte sich sehr über diese Art der Bezahlung und warf die Steine voller Wut ins Feuer. Wie überrascht war er allerdings, als goldene Tropfen aus ihnen hervorquollen. Mit dem Gold, so sagt man, konnte der Waldgrabnerhof neu gebaut werden.
In einer anderen Version bat der Schatzsucher den Waldgrabner, ihm einen sicheren Weg auf den Sandling zu zeigen. Dieser führte den Fremden auch dorthin. Als der Erzsucher sich verabschiedete, versteckte sich der Bauer in einer Felsspalte, um die für ihn merkwürdige Gestalt bei ihrem Tun zu beobachten. Das Wauggerl suchte im Bach nach Steinen, und nach genauerem Inspizieren landete der eine oder andere davon in dessen Kraxn. Als der Schatzsucher den Waldgrabner bemerkte, schoss er auf ihn, verfehlte ihn aber. Daraufhin schlug der Bauer den Erzsucher zu Boden. Als dieser um sein Leben fürchtete und zu flehen begann, besann sich der Waldgrabner und trug den Schatzsucher mitsamt den Steinen nach Hause. In der Nacht machte sich das Wauggerl aus dem Staub, zündete aus Rache über seine Niederlage allerdings zuvor noch den Waldgrabnerhof an. In der Asche fand der Waldgrabner – an der Stelle, an der die Kraxn noch am Abend zuvor gestanden hatte – einen Klumpen Gold. Der Bauer verkaufte das Gold, um mit dem Erlös seinen Hof neu aufzubauen.
DIE WILDFRAUEN
Das Wort „wild“ hatte im Mittelhochdeutschen, das zu der Zeit gesprochen wurde, als viele der Sagen entstanden sind, noch eine ganz andere Bedeutung, als wir sie heute kennen. Damals bedeutete es ungefähr so viel wie „frei“ oder auch „unabhängig“ – daher waren die „freien Frauen“ eben die „Wildfrauen“. Und im Trisselbergloch, das ist eine Halbhöhle in der Trisselwand, lebten in früherer Zeit einige dieser „Wildfrauen“, welche man auch als die „Saligen“ bezeichnete. Diesen speziellen Begriff kennen wir ja unter anderem bereits aus der Sage vom „Geschenk an die Saligen“.
Illustration © Philipp Pamminger
An schönen, sonnigen Tagen konnte man die weiße Wäsche der Wildfrauen, die sie draußen vor dem Höhleneingang zum Trocknen aufgehängt hatten, sogar aus großer Entfernung vor dem Trisselbergloch schimmern sehen. Die Wildfrauen waren sehr fleißig, äußerst bescheiden und durchaus schüchtern, aber zugleich auch extrem neugierig. Deshalb wollten sie die Menschen, die unten im Dorf wohnten, unbedingt kennenlernen und mehr über sie und ihre Gewohnheiten erfahren.
So geschah es, dass eines Tages ein Mädchen unerwartet auf einem der Bauernhöfe im Dorf auftauchte und fragte, ob sie denn auf diesem Hof als Magd arbeiten dürfe. Der Bauer und die Bäuerin waren sehr erleichtert über die Hilfe, die ihnen als Unterstützung bei der vielen Arbeit dienen würde. Sie einigten sich auch schnell darüber, welche Tätigkeiten das Mädchen zu verrichten hätte und was sie dafür als Gegenleistung erhalten würde. Als sie alles ausgehandelt hatten, wandte sich die Magd noch an die Bauersleute und sagte zu ihnen: „Nur oa oanzige Bitte hätt i nu, damit i bei eich oabeitn konn: Frogts mi bitte nia, bitte wirklich nia, woher i kumm, denn dånn miassat i sufuat von då weggehn.“ Die Bauersleute versprachen es ihr hoch und heilig – und sie hielten eisern Wort.
So verstrich einige Zeit. Die Magd konnte sehr gut mit den Tieren umgehen, sie konnte Brot backen, hielt das Haus sauber und half auch so oft es ging bei der Feldarbeit. Aber eines Tages kam Michl, der älteste Sohn, der weit entfernt wohnte und dort arbeitete, auf den Hof zu Besuch. Er wusste nichts von dem Versprechen, das seine Eltern gegebenen hatten. Da ihm die junge, fleißige Magd sehr gut gefiel, fragte er sie gleich aus Gewohnheit heraus: „Jå, Dirndl, i håb di nu nia gsegn, woher kimmst denn du?“ Kaum hatte er diese Frage gestellt, stieß die Magd einen lauten Schrei aus und rief voller Entsetzen: „Jez muaß i fuatgehn und derf neama kemma!“ Sie verschwand augenblicklich – und zurück blieb nur ein äußerst überraschter junger Mann, der überhaupt nicht wusste, dass die junge Magd eine „Salige“, eine junge Wildfrau aus dem Trisselbergloch, war und welche Abmachung sie und seine Eltern hatten. Aber manchmal, wenn die Sonne den Morgennebel verschwinden ließ, dann, ja, dann sah der junge Mann ein ganz besonders weißes, duftiges, zartes Wäschestück vor dem Trisselbergloch aufblitzen und er dachte sogleich an die liebliche, hilfsbereite „Wildfrau“, die er getroffen hatte.
BONUS – WIE MAN FRÜHER SALZ GEWANN
Ein Schäfer aus dem Ort brachte die Schafe der Bauern und Fischer täglich auf die Bergwiesen am Sandling, und die Tiere folgten ihm stets willig in Richtung Moosberg. Dort angekommen, tranken die Tiere immer begierig das Quellwasser, das an einzelnen Stellen zutage trat. Eines Tages wurde der Schäfer neugierig und kostete das Wasser, spuckte es jedoch sogleich wieder aus, da es sehr salzig schmeckte. Am Abend erzählte er den Besitzern der Schafe von seiner Entdeckung. Diese machten sich nun ebenfalls auf den Weg in Richtung Moosberg und tranken von dem Quellwasser, das ihnen ganz und gar nicht schmeckte.
Illustration © Philipp Pamminger
Ein kluges, neugieriges Bürschchen erfuhr von diesen Kostproben und wagte einen Versuch: Er füllte das Wasser aus den Quellen in einen Holztrog und warf anschließend einige glühende Steine hinein. Plötzlich zischte und brodelte es, dann hörte man ein lautes Sausen und Brausen. Nach einer Weile war das gesamte Wasser verdampft und die Steine sahen auf einmal ganz anders aus, denn sie waren mit lauter feinen, weißen Salzkristallen überzogen. Der quasi „Erfinder“ der ersten Salzsiedesanlage in Altaussee schabte das Salz dann behutsam ab und verwendete es fortan zum Würzen seiner Speisen.
In diesem Fall mag wohl das bei den Schafen gesteigerte Bedürfnis nach zusätzlichem Salz – genauer gesagt Natriumchlorid – der Grund dafür gewesen sein, dass das auf natürlichem Wege entstandene salzhaltige Wasser aus dem Sandling, das fortan als Sole bezeichnet wurde, letztendlich von den Altausseern entdeckt werden konnte. Viele Pflanzenfresser nehmen nämlich nur wenig Natrium mit der Nahrung auf, obwohl es für viele wichtige Funktionen verantwortlich zeichnet, beispielsweise, indem es die Eiweißverdauung der Tiere erheblich begünstigt. Salz ist aber auch allgemein ein wichtiger Mineralstoff für sämtliche Lebewesen.
Doch es gab noch andere Arten, wie die Menschen in der Region herausfanden, dass in ihren Bergen große Salzvorkommen existierten. Der Sage nach etwa durch den Hinweis des Wassermanns vom Altausseer See, dass in den roten Steinen des Sandling Salz enthalten sei. Er gab sogar einen Hinweis, wie man es gewinnen konnte, nämlich dass man es mithilfe von Wasser aus den Steinen lösen und anschließend aus dem Wasser heraussieden könne.
Wie es letztendlich auch angestellt wurde, um das kostbare und wertvolle Salz zu gewinnen: Was im Kleinen und noch recht umständlich begann, entwickelte sich mit der Zeit zu einem echten Beruf. Nach und nach wurden die ersten Sudpfannen entwickelt, um größere Mengen Salz aus der Sole zu gewinnen. Die Sole wurde schließlich in hölzernen Röhren ins Tal geleitet, wo sie in den inzwischen entstanden Sudhäusern weiterverarbeitet wurde. Mit wachsender Erfahrung gelang es, die Salzgewinnung immer effizienter zu gestalten, und schon bald wurde das „weiße Gold“ zu einem wesentlichen Wirtschaftszweig der Region. Das Salz sicherte nicht nur den Wohlstand vieler Generationen, sondern gab dem gesamten Gebiet auch seinen Namen: das Salzkammergut.
Beauftragt von der LOSER BERGBAHNEN GMBH & CO KG
Projektteam:
Konzeption/Redaktion/Projektleitung: KULTURFUX – Die Ausstellungsmacherin, Gampern
Inhaltliche Beratung/Expertise/Texte Audioguide: Monika Gaiswinkler, Altaussee
Illustrationen AUGSTI: Philipp Pamminger, Linz
Texte/Übersetzung Tafeln, Sagentexte deutsch online: eo communications, Strobl
Grafische Gestaltung/Tafelproduktion: DESIGNEREI, Bad Aussee
AR-AUGSTI: SMESH OG, Linz
Audioguide-Produktion: ATP-Records, Altaussee (Aufnahme); Hearonymus GmbH, Wien (Audioguide-App)
Sprecherinnen: Monika Gaiswinkler (Deutsch), Eva Beerova (Tschechisch), Sarah Raich (Englisch)
Gefördert als Leaderprojekt der LEADER Regionalentwicklung Ennstal-Ausseerland